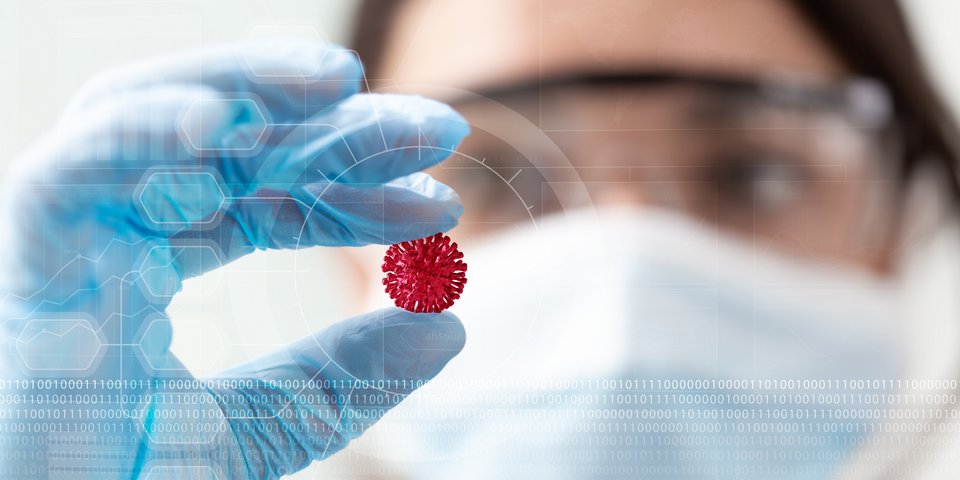 ©Paulista - stock.adobe.com
©Paulista - stock.adobe.comLeben und Arbeit in Zeiten der Covid-19-Pandemie
Deutliche Anzeichen der „Ermüdung“.
SW – 05/2021
Die psychische
Gesundheit und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Maßnahmen der EU und der Regierungen der
Mitgliedstaaten haben seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie abgenommen. Zu diesem
Ergebnis kommt die Studie „Leben, Arbeiten und Covid-19“ der
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound),
die die soziale und wirtschaftliche Lage der Menschen in Europa im Frühjahr 2021 beleuchtet (Text liegt nur in Englisch vor).
Psychisches Wohlbefinden auf Tiefststand
Nach einem Jahr COVID-19-Pandemie und einer Reihe vollständiger
Lockdowns zeige die Bevölkerung Europas spürbare Anzeichen der „Ermüdung“. Das
psychische Wohlbefinden habe in allen Altersgruppen den niedrigsten Stand seit
Beginn der Pandemie erreicht. Besonders betroffen seien hiervon junge Menschen
und diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Ein Jahr nach der Schließung der ersten
Unternehmen aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie waren 10 Prozent der
Befragten, die vor der Pandemie beschäftigt waren, arbeitslos, ein Anstieg von
zwei Prozentpunkten gegenüber der Situation im Sommer 2020 (8 Prozent) und
doppelt so hoch wie im Frühjahr 2020 (5 Prozent).
Bei den jungen Menschen sind diejenigen
im Alter von 18 bis 29 Jahren am stärksten betroffen, 17 Prozent waren zuletzt arbeitslos,
verglichen mit 9 Prozent der über 30-Jährigen. Gleichzeitig stieg die
Arbeitsplatzunsicherheit bei denjenigen, die einen Arbeitsplatz hatten. Das
Gefühl, ihren Arbeitsplatz in den nächsten drei Monaten zu verlieren, war
zu Beginn der Pandemie am schlimmsten (33 Prozent), verbesserte sich bis zum
Sommer 2020 deutlich (24 Prozent) und verschlechterte sich im Frühjahr 2021
erneut (26 Prozent).
Zunehmende Ungleichheiten
Die
bestehenden Ungleichheiten hinsichtlich besonders schutzbedürftiger Gruppen haben pandemiebedingt zugenommen. Über Schwierigkeiten, bis zum Ende
eines Monats finanziell „über die Runden zu kommen“, berichten insbesondere denjenigen,
die sich in einer prekären Lage befinden, wie Personen, die finanzielle
Unterstützung beantragt, aber nicht erhalten haben, die während
der Pandemie ihre Arbeit verloren haben oder bereits arbeitslos waren. Gezeigt hat
die Umfrage auch die erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Der
Anteil variiert zwischen 14 Prozent der Befragten in Dänemark, die über
entsprechende finanzielle Schwierigkeiten berichten, bis zu 74 Prozent der
Befragten in Kroatien.
Abnehmende Zufriedenheit
Die
Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit Krisenunterstützungsmaßnahmen ist deutlich
zurückgegangen, nur 12 Prozent sind der Meinung, dass Unterstützungsmaßnahmen
fair sind, gegenüber 22 Prozent im Sommer 2020. Der Anteil derjenigen, die der
Ansicht waren, dass Unterstützungsmaßnahmen einfach und effizient sind, ging
von 16 Prozent im Sommer 2020 auf 10 Prozent im Frühjahr 2021 zurück.
Skepsis gegenüber Impfstoffen
Auch
das Vertrauen in die Impfstoffe ist nicht uneingeschränkt.
Mehr als ein Viertel der europäischen Bürgerinnen und Bürger haben eine eher skeptische
Haltung gegenüber den COVID-19-Impfstoffen. Die Einstellung zu den Impfstoffen korreliert mit dem Vertrauen in die jeweiligen Regierungen und der Nutzung Sozialer
Medien.
In Ländern mit geringerem Vertrauen in die eigene Regierung sind
Bürgerinnen und Bürger skeptischer. Darüber hinaus hat die Frage der Hauptinformationsquelle
erheblichen Einfluss. Während starke Nutzer Sozialer Medien (drei oder mehr
Stunden täglich) etwas zögerlicher sind (30 Prozent) als andere (26
Prozent), steigt der Anteil der Impfstoffskeptiker unter denjenigen, die Soziale
Medien als Hauptnachrichtenquelle nutzen, auf 40 Prozent. Unter denjenigen, die
traditionelle Nachrichtenquellen (Presse, Fernsehen und Radio) als
Hauptinformationsquelle verwenden, beträgt der Anteil der Impfstoffskeptiker
nur 18 Prozent.
Vertrauen zurückgewinnen
Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Verhinderung wirtschaftlicher
und sozialer Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten und ihren Bürgerinnen
und Bürgern unabdingbar sei, da andernfalls das ohnehin schwache Vertrauen in
die Regierungen und in das Projekt der Europäischen Union weiter untergraben
werde und die politische Unzufriedenheit im Hinblick auf den „europäischen
Gesellschaftsvertrag“ wachse.
